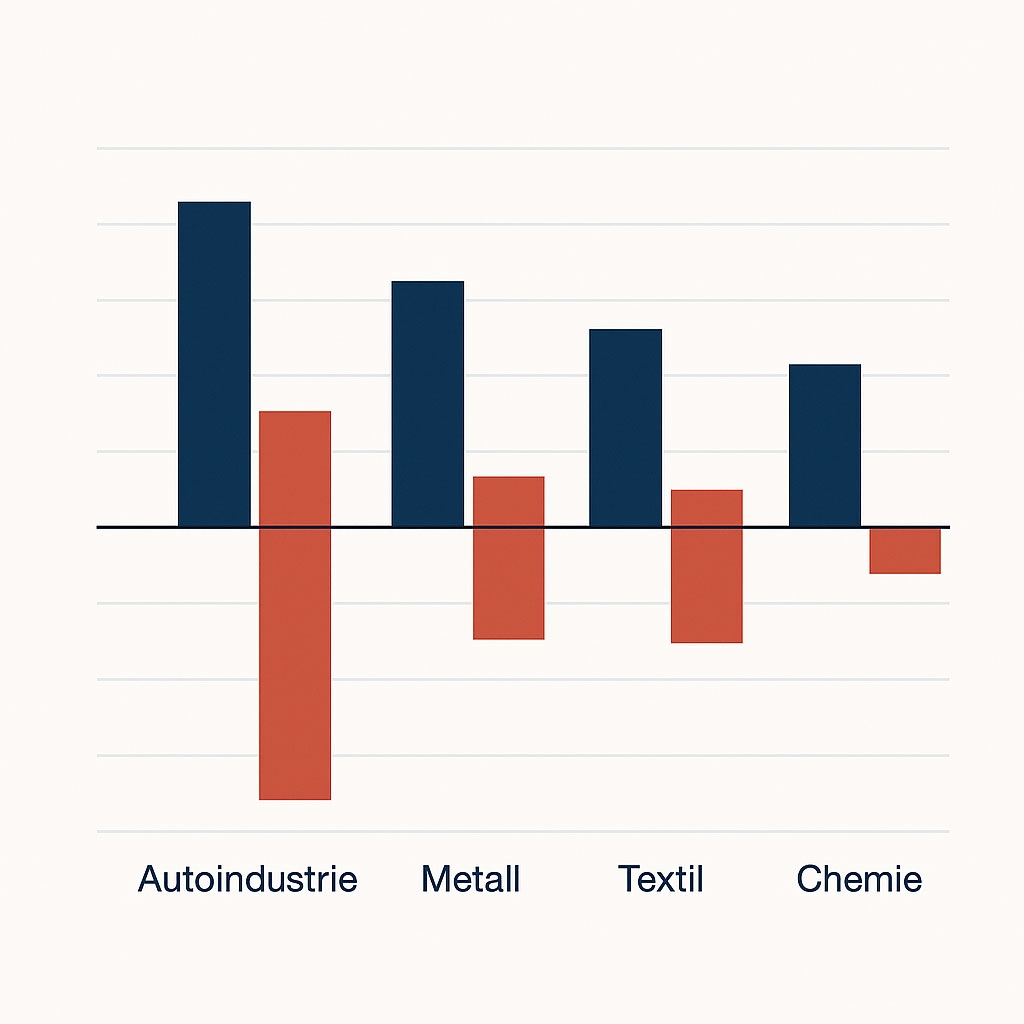Die Lage in der Metall- und Elektroindustrie – Gründe für den Niedergang und Wege aus der Dauerkrise
Die Metall- und Elektroindustrie (M+E) bildet das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Mit rund vier Millionen Beschäftigten ist sie der größte industrielle Arbeitgeber des Landes und stellt zentrale Komponenten für Maschinenbau, Automobilindustrie, Energietechnik und Elektrotechnik her.
Doch dieses Fundament gerät zunehmend ins Wanken. Die Branche steckt in einer Dauerkrise: Acht Quartale in Folge stagniert die Produktion, Auftragseingänge brechen ein und Unternehmen lagern zunehmend Produktionskapazitäten ins Ausland aus. Laut Angaben des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall sind allein seit dem Jahr 2023 rund 130.000 Arbeitsplätze verloren gegangen – Tendenz steigend.
Die Ursachen für diese Entwicklung sind komplex und vielschichtig: Sie reichen von gestiegenen Energiepreisen über geopolitische Verwerfungen bis hin zu strukturellen Problemen im Inland. Die Suche nach Lösungen ist längst zu einem gesellschaftlichen Kraftakt geworden, an dem Gewerkschaften, Arbeitgeber und Politik beteiligt sind.
Gründe für den Niedergang
Schwache Nachfrage und Auftragsrückgänge
Ein zentraler Grund für die gegenwärtige Misere liegt in der Nachfrageseite. Viele Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie berichten von drastischen Auftragsrückgängen. Laut einer Umfrage des ifo-Instituts aus dem Frühjahr 2025 beklagen fast 48 % der Betriebe in der M+E-Branche eine unzureichende Nachfrage – ein Rekordwert. Globaler Konsum stagniert, Investitionen werden zurückgestellt, und die anhaltenden Unsicherheiten durch geopolitische Konflikte wie den Krieg in der Ukraine oder die Handelsspannungen mit China verschärfen die Lage zusätzlich.
Hinzu kommt: Die schleppende Konjunktur in Deutschland selbst wirkt wie ein Katalysator. Wenn Maschinenbauer oder Autohersteller weniger investieren oder produzieren, wirkt sich dies unmittelbar auf Zulieferer in der M+E-Industrie aus.
Kosten- und Wettbewerbsdruck
Ein weiteres zentrales Problem ist der Kostenfaktor. Insbesondere die massiv gestiegenen Energiepreise machen vielen Unternehmen zu schaffen. Deutschland zählt zu den Ländern mit den höchsten Stromkosten weltweit. Im internationalen Vergleich sind die Wettbewerbsbedingungen daher deutlich ungünstiger: Während etwa in den USA oder China durch Subventionen und niedrigere Abgaben energieintensive Produktionen weiterhin wirtschaftlich betrieben werden können, steigen in Deutschland die Produktionskosten in untragbare Höhen.
Dazu kommen weitere Belastungen: eine ausufernde Bürokratie, hohe Lohnnebenkosten, Steuerlasten sowie ein zunehmend unberechenbares regulatorisches Umfeld. Besonders für mittelständische Unternehmen wird es damit schwer, im globalen Wettbewerb zu bestehen.
Struktur- und Transformationsdruck
Die Branche steht zugleich vor einem tiefgreifenden Strukturwandel. Digitalisierung, Automatisierung und die grüne Transformation sind notwendig, um zukunftsfähig zu bleiben – erfordern jedoch enorme Investitionen. Doch gerade diese Transformation gelingt vielen Unternehmen nicht oder nur schleppend. Nicht selten fehlt es an Kapital, Know-how oder auch geeigneten Fachkräften.
Zudem wird kritisiert, dass der Staat zwar ambitionierte Klimaziele und Regulierungen vorgibt, jedoch nicht in ausreichendem Maße für Rahmenbedingungen sorgt, die eine nachhaltige Transformation auch wirtschaftlich tragfähig machen. Gesamtmetall spricht gar von einer „schleichenden Deindustrialisierung“, die sich durch die Kombination aus Überforderung, unklarer Perspektive und mangelnder staatlicher Unterstützung beschleunige.
Tarifpolitik und Arbeitskosten
Auch die tarifpolitische Lage trägt zur Belastung bei. Die IG Metall fordert in der aktuellen Tarifrunde höhere Löhne, Inflationsausgleichsprämien und eine Verkürzung der Arbeitszeit auf eine 4-Tage-Woche – und das bei vollem Lohnausgleich. Die Arbeitgeber hingegen argumentieren, dass solche Forderungen angesichts der wirtschaftlich angespannten Lage und sinkender Aufträge schlichtweg nicht zu erfüllen seien.
Diese Diskrepanz erschwert die Einigung am Verhandlungstisch – und verstärkt den Druck auf Betriebe, insbesondere im Mittelstand, die weder hohe Tarifabschlüsse noch Strukturkosten dauerhaft stemmen können. Das Ergebnis: Investitionen werden zurückgehalten oder ins Ausland verlagert.
Abwanderung von Produktionskapazitäten
Eine der sichtbarsten Folgen der Dauerkrise ist die Abwanderung. Immer mehr Unternehmen erwägen die Verlagerung ihrer Produktion ins Ausland. Laut einer aktuellen Umfrage von Gesamtmetall denken rund 22 % der befragten Unternehmen darüber nach, Produktionslinien zu schließen oder ins Ausland zu verlagern. Besonders betroffen sind energieintensive Branchen wie Aluminiumverarbeitung, Stahl oder Teile der Elektrotechnik.
Der Standort Deutschland verliert damit nicht nur industrielle Wertschöpfung, sondern auch Innovationskraft und gut bezahlte Arbeitsplätze. Die Tendenz zur Entindustrialisierung ist somit nicht mehr nur ein theoretisches Szenario, sondern bereits gelebte Realität.
Akute Folgen
Die Folgen dieser Entwicklung sind bereits heute deutlich spürbar. Seit 2023 sind nach aktuellen Erhebungen mehr als 130.000 Arbeitsplätze in der Branche verloren gegangen – betroffen sind nicht nur klassische Industriezentren wie Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen, sondern auch kleinere Regionen, in denen einzelne Betriebe eine zentrale wirtschaftliche Rolle spielen.
Die Produktionsleistung der gesamten M+E-Industrie ist auf das Niveau von vor über zehn Jahren zurückgefallen. Die Kapazitätsauslastung liegt aktuell bei etwa 82 %, was unter dem langfristigen Durchschnitt liegt. Der Innovationsstau ist ein weiterer Nebeneffekt: Ohne klare Perspektive und bei schwindenden Margen scheuen Unternehmen Investitionen in Forschung und Entwicklung.
Gleichzeitig sinkt die Attraktivität des Standorts Deutschland aus Sicht der Unternehmer. Laut einer Umfrage von Bild/IG Metall gaben 67 % der Betriebe an, dass sich die Standortbedingungen in den letzten Jahren erheblich verschlechtert hätten.
Wege aus der Dauerkrise – Lösungsansätze
Politische Unterstützung stärken
Ein zentrales Anliegen der Industrievertreter und Gewerkschaften ist die Schaffung verlässlicher politischer Rahmenbedingungen. Dazu zählen insbesondere wettbewerbsfähige Energiepreise. Die Stromsteuer müsse gesenkt, Netzentgelte reformiert und industrielle Großverbraucher durch gezielte Subventionen entlastet werden, fordern Gesamtmetall und IG Metall unisono.
Darüber hinaus wird ein industriepolitischer Masterplan gefordert, der klare Investitionsanreize setzt – etwa durch steuerliche Forschungsförderung, die Förderung klimaneutraler Produktionsverfahren und den Abbau von überflüssiger Bürokratie.
Europäische Industriecharta und Leitmärkte fördern
Viele Experten fordern zudem ein gemeinsames europäisches Vorgehen. Eine europäische Industriecharta soll künftig sicherstellen, dass Leitmärkte wie Wasserstofftechnologie, grüner Stahl oder Halbleiterproduktion gezielt unterstützt und gegen internationale Dumpingpreise geschützt werden.
Maßnahmen wie „Green Public Procurement“ (umweltgerechte öffentliche Beschaffung) oder die Festlegung von CO₂-Standards für importierte Produkte könnten dazu beitragen, ein Level-Playing-Field herzustellen. Zudem könnten europäische Fördergelder für Transformationsprojekte bündeln und grenzüberschreitend nutzbar machen.
Arbeitszeitmodelle und Qualifizierung
Ein weiteres zentrales Element auf dem Weg aus der Krise ist die Reform von Arbeitszeit- und Qualifizierungsmodellen. Pilotprojekte zur 4-Tage-Woche – etwa im Rahmen von Tarifverträgen mit Qualifizierungskomponente – zeigen erste positive Wirkungen: Beschäftigte werden entlastet, während freie Kapazitäten für Weiterbildungsmaßnahmen genutzt werden können.
Angesichts des technologischen Wandels und des demografischen Wandels ist zudem eine massive Investition in Aus- und Weiterbildung notwendig. Umschulungen in den Bereichen Halbleitertechnik, Recyclingindustrie, digitale Prozesssteuerung oder grüner Energieproduktion könnten den Übergang in neue industrielle Segmente erleichtern.
Innovations- und Transformationsförderung
Staatlich geförderte Innovations-Cluster, Start-up-Förderung in Green-Tech-Bereichen und gezielte Anreize für industrielle Großprojekte – etwa bei CO₂-neutraler Stahlproduktion oder Speichertechnologien – können einen Hebeleffekt erzielen. Laut einer Studie der Fraunhofer-Gesellschaft lassen sich durch den Einsatz von intelligenten Stromspeichern in der Industrie bis zu 56 % der Energiekosten einsparen.
Auch der Zugang zu Kapital, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, muss verbessert werden. Bürgschaften, steuerliche Innovationsabschreibungen oder spezielle Kreditprogramme der KfW könnten hier Abhilfe schaffen.
Standorte stabilisieren und Beschäftigung sichern
Um Standortschließungen zu verhindern, braucht es gezielte regionale Strukturhilfen. Kommunale Industriefonds, gezielte Ansiedlungspolitik und eine stärkere Einbindung von Sozialpartnern in Transformationsprozesse können helfen, regionale Wertschöpfung zu erhalten.
Tarifverträge mit langfristigen Beschäftigungsgarantien, Übernahmeoptionen für Auszubildende und innovative Beteiligungsmodelle (z. B. Mitarbeiterkapitalbeteiligung) stärken zudem das Vertrauen der Belegschaften – ein entscheidender Faktor in Krisenzeiten.
Ein Wendepunkt
Die Metall- und Elektroindustrie steht an einem Wendepunkt. Die Kombination aus konjunktureller Schwäche, internationalem Kostenwettbewerb, politischem Reformstau und struktureller Überforderung hat eine Situation geschaffen, die ein entschlossenes Handeln erfordert.
Gleichzeitig zeigt sich aber auch: Die Bereitschaft zur Veränderung ist da – bei Arbeitgebern wie Arbeitnehmern. Wenn die richtigen politischen Impulse gesetzt werden, kann die Transformation gelingen. Die Voraussetzung: eine klare Industriepolitik, verlässliche Energiekosten, gezielte Förderung und eine starke Sozialpartnerschaft.
Ohne ein solches Maßnahmenpaket droht jedoch nicht weniger als der schleichende Verlust industrieller Wertschöpfung und technologischer Souveränität – mit langfristig verheerenden Folgen für Wohlstand, Arbeitsplätze und Innovationsfähigkeit in Deutschland.
Die Metall- und Elektroindustrie ist zu wichtig, um sie ihrem Schicksal zu überlassen. Jetzt ist die Zeit für mutige Entscheidungen – im Interesse von Millionen Beschäftigten und der Zukunft des Industriestandorts Deutschland.